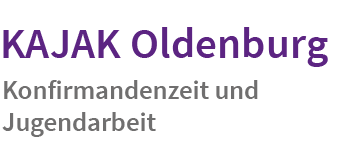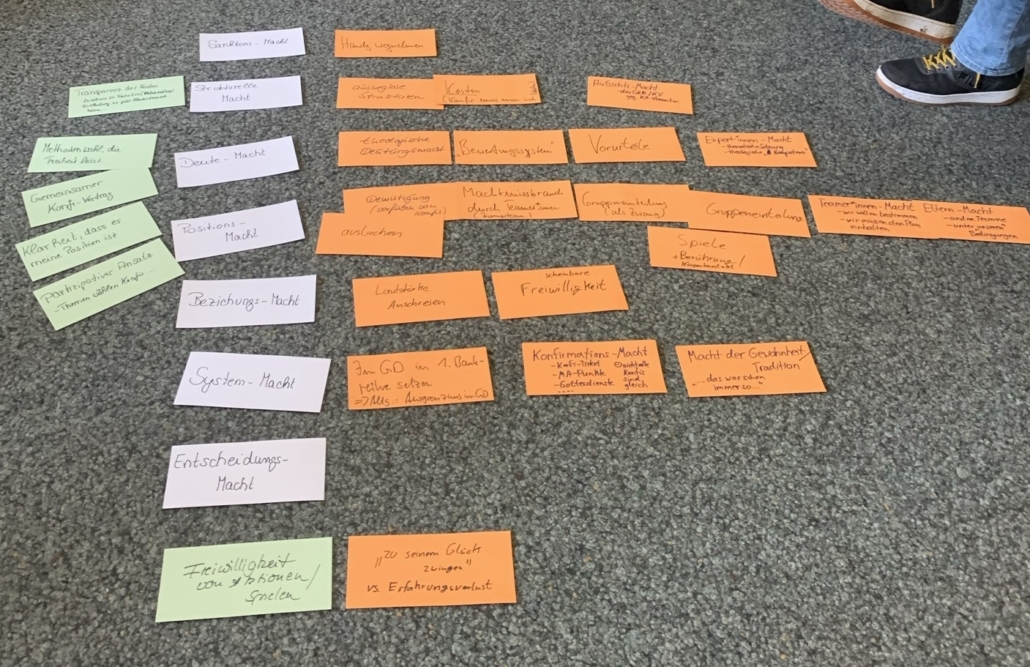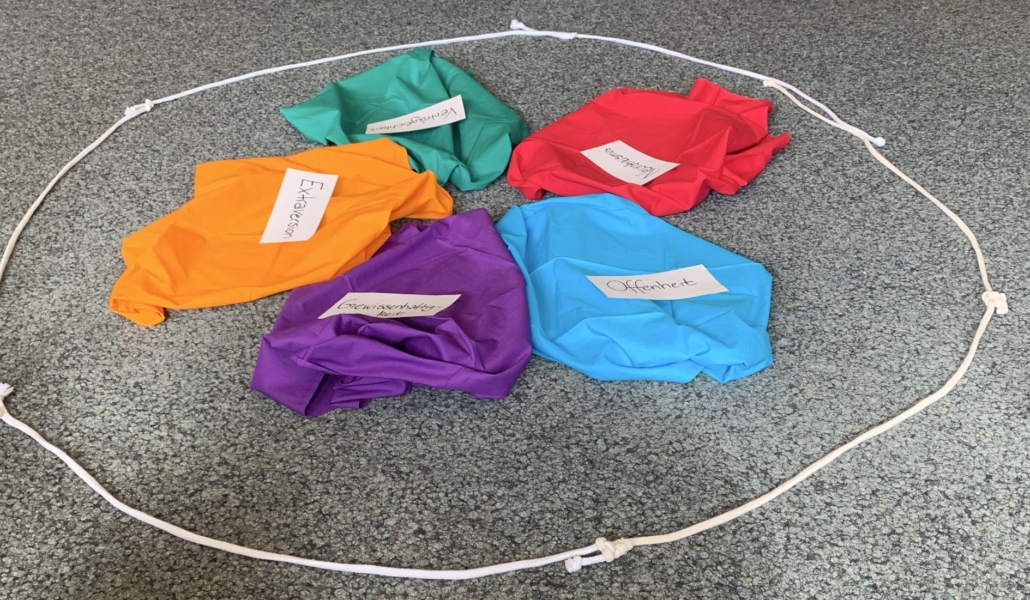Öffentlich und angstfrei miteinander streiten!
„Ich markiere meine Position!“ Das ist das mindeste, was ich tun kann, wenn ich mit einer Meinung konfrontiert werde, die absolut gegen meine Überzeugung ist. Das geht als Pastor*in auch bei einem Geburtstags- oder Trauerbesuch. Wenn jemand beim gemütlichen Kaffeetrinken ausländerfeindliche, rassistische, antisemitische oder andere Parolen in die Runde wirft, ist das vielleicht nicht der Ort, ausführlich eine Gegenposition zu entfalten. Aber meine Position „markieren“, das kann ich wohl. Ich bin sogar, das ist meine Meinung, in populistischen Zeiten dazu verpflichtet. „Moment, da bin ich aber ganz anderer Meinung…. Mich würde sehr interessieren, wie sie Ihre Meinung begründen.“ Und wenn ich es mir zutraue, kann ich ja zu einem ausführlichen Gespräch an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit einladen.
„Mit Rechten reden!“ war das Thema eines Kacheltalks einiger deutschsprachigen Pastoralkollegs am 26.3. mit über 70 Teilnehmer*innen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Rumänien… Dr. Frank Hiddemann, Gründer der Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg, traut sich schon seit vielen Jahren, sich öffentlich mit Positionen der Neuen Rechten auseinanderzusetzen. Er ist davon überzeugt, dass die gesellschaftliche Ächtung extremer Positionen nicht weiterhilft. Wer das tut, wird mit der Zeit nämlich denkfaul und verliert selbst an gesellschaftlichen Boden.
In sachlich geführten Diskussionen zeigt sich, dass rechtspopulistische Themen ihr Durchschlagskraft verlieren, sobald man sie auf ihre praktische Umsetzbarkeit prüft. Politikfelder zu besetzen und gesellschaftliche Probleme anzusprechen, die von allen Parteien nur schwer zu bewältigen sind, ist das eine. Kluge Alternativen, die sich umsetzen lassen, sind das andere.
Frank Hiddemann berät Kirchengemeinden und demokratische Netzwerke bei der Entwicklung von öffentlichen Formaten. Seine grundlegenden Tipps: 1. Öffentlichkeit herstellen: Gruppen mit verschiedenen Meinungen einladen, nicht übereinander reden, sondern miteinander streiten)
2. Hochritualisierte Struktur des Gesprächs: Expertenimpuls, Positionen anhören, Raum für Publikumsfragen, Expertenfazit
3. Eine Gesprächsreihe anbieten, um Raum und Zeit für mehrere Themen zu haben, die strittig sind
4. Moderation ohne Lagerapplaus: Zwischenfragen stellen, bevor es zu Parolen kommt; einander ausreden lassen und es nicht gleich besser wissen wollen
Eine Pfarrerin merkte an, dass es für sie nicht leicht sei, mitten im Alltag so eine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen. Vielleicht ist das ja ein Anlass, vor Ort oder in der Region sich mit den demokratischen Kräften zusammenzutun. Gemeinsam lässt sich hier oft mehr, sowohl quantitativ als auch qualitativ erreichen.
Eine theologische Begründung, warum wir uns der Auseinandersetzung stellen müssen, liefert Frank Hiddemann übrigens auch: „Wir sind beauftragt, die bösen Geister auszutreiben!“ Worauf also noch warten?
Ach ja, noch ein wichtiger Hinweis: Es lohnt sich, solche Format in Kirchen durchzuführen. Sie haben, so die Erfahrung, eine besondere Aura und sorgen dafür, dass selbst hartgesottene Populisten ahnen, dass in diesen Räumen mit Widerstand gegen allzu plumpe Ideologien zu rechnen ist.
Auch auf EKD-Ebene gibt es eine Initiative, die einlädt, Räume für Auseinandersetzung zu schaffen: #VerständigungsOrte